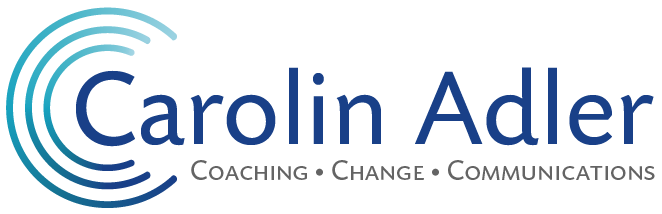Vom Störgeräusch zum Navigationssystem: Wie acht uralte Muster heute Coaching, Führung & Change wirksam verändern
Kennst du das? Du betrittst einen Meetingraum, und bevor die Agenda überhaupt startet, liegt schon eine bestimmte Stimmung in der Luft:
👉 „Das bringt doch eh nichts…“ 👉 „Und was, wenn alles schiefgeht?“ 👉 „Wir müssen uns einfach mehr anstrengen!“ 👉 „Warum immer wir…“
Viele Führungskräfte und Coaches erleben diese Stimmen als lästig, bremsend oder sogar gefährlich für den Erfolg von Veränderungsprozessen. Widerstand höre ich dazu oft. Und ja – sie können blockieren, verlangsamen, Energie ziehen.
Doch hier kommt die überraschende Wahrheit: Diese Stimmen sind keine Schwächen. Sie sind keine Störungen. Sie sind evolutionäre Programme und Echo-Muster, die uns seit Jahrtausenden begleiten – und die heute noch unsere Entscheidungen, Ängste und Hoffnungen prägen.
- Jammern war einst ein Ruf nach Nähe – heute Ausdruck von Zugehörigkeitsbedürfnissen.
- Grübeln sicherte früher das Überleben – heute zeigt es den Wunsch nach Sicherheit.
- Innere Kritik schützte den Status in der Gruppe – heute spiegeln sie den Drang nach Anerkennung.
Wer diese Muster erkennt, versteht, dass jedes „Störgeräusch“ in Wahrheit ein Navigationssignal ist. Ein Hinweis auf Bedürfnisse, die erfüllt werden wollen.
Und genau das macht den Unterschied: Ob du (leise und laute) Stimmen als Widerstand bekämpfst – oder sie als Kompass für Führung, Coaching und Change liest. Es sind nicht nur äußere Stimmen im Raum. Es sind innere Stimmen, die im Meeting hörbar werden.
Die 8 Archetypen der inneren Sprache – ein Überblick
Damit wir diese Stimmen nicht als bloßes Störgeräusch abtun, sondern als Kompass nutzen, habe ich die acht Archetypen der inneren Sprache zusammengestellt. Sie beschreiben, woher ein Muster stammt, wie es neuropsychologisch funktioniert und welches Bedürfnis es aufzeigt, mit dem wir in Coaching, Führung und Veränderungsbegleitung weiterarbeiten können.

1. Jammern & Klagen
- Evolutionäre Herkunft: In Herden- oder Stammeskulturen waren Jammern und Klagen ein „Sozialsignal“. „Ich brauche Nähe, helft mir!“ Wer jammerte und klagte, zog die Aufmerksamkeit auf sich, suchte Trost und Nähe und sicherte sich so Bindung und Zugehörigkeit.
- Neuro-Hintergrund:Es aktiviert das Bindungssystem (Oxytocin, ventrales Vagus-System), das für Nähe und Fürsorge sorgen.. Jammern ist unbewusst eine Einladung: „Sieh mich, hör mich, halte mich in der Gruppe.“
- Psychologische Bedürfnisse:Bindung, Zugehörigkeit, Soziale Sicherheit, Anerkennung, Integration
- Beispielsätze: 👉 „Immer muss ich alles alleine machen, sieht das denn keiner?“👉 „Warum trifft es eigentlich immer uns?“👉 „Ich habe das Gefühl, hier interessiert sich niemand für meine Sorgen.“
2. Grübeln & Sorgen
- Evolutionäre Herkunft: Unsere Vorfahren überlebten, weil sie Gefahren antizipierten. Grübeln stammt aus dem „Gefahr-vorwegnehmen“-Modus. In kleinen Gruppen war es überlebenswichtig, mögliche Bedrohungen (Raubtiere, Konflikte, Nahrungsknappheit) durchzuspielen.
- Neuro-Hintergrund: Hier arbeitet die Amygdala für Gefahrenerkennung zusammen mit präfrontalem Kortex für Szenarioplanung. Grübeln hält die Stressachse (HPA-Achse) aktiv und soll eigentlich zur Handlungsplanung führen.
- Psychologische Bedürfnisse: Sicherheit, Kontrolle, Vorhersagbarkeit.
- Beispielsätze: 👉 „Und was, wenn wir am Ende scheitern?“👉 „Ich kann nachts nicht schlafen, weil ich ständig an alle Risiken denke.“👉 „Vielleicht haben wir etwas Wichtiges übersehen, das uns später auf die Füße fällt.“
3. Selbstkritik & Antreiber
- Evolutionäre Herkunft:Wer sich selbst streng beurteilte, vermied Fehler – und die Gefahr sanktioniert zu werden. In einer hierarchischen Gruppe konnte es tödlich sein, den Anführer herauszufordern. Innere Selbstkritik half, sich selbst kleinzuhalten und sozial akzeptabel zu bleiben. So sicherte man den Status und das soziale Gefüge in der Gruppe.
- Neuro-Hintergrund: Eng verbunden mit dem anterior cingulären Cortex (Fehlerdetektion) und dem dopaminergen Lernsystem (Belohnung/Strafe).
- Psychologische Bedürfnisse: Akzeptanz, Anerkennung, Statussicherung, Vermeidung von Ausschluss, Selbstwert.
- Beispielsätze: 👉 „Das war wieder nicht gut genug – das hätten wir besser machen müssen.“👉 „Wenn ich einen Fehler mache, verliere ich sofort an Ansehen.“👉 „Ich darf keine Schwäche zeigen, sonst verliere ich meinen Platz.“ (Diese Stimmen wirken eher im inneren, im Coaching kommt es eher raus als in einer Gruppensituation in der Organisation)
4. Beschwichtigen & Schönreden
- Evolutionäre Herkunft:In Gruppen musste man Konflikte entschärfen und Frieden stiften, um die Gemeinschaft zusammenzuhalten. Diese sorgte schließlich fürs Überleben. Beschwichtigen diente dazu, Aggressionen zu deeskalieren.
- Neuro-Hintergrund: Vagus und limbisches System regulieren Spannungen.
- Psychologische Bedürfnisse: Harmonie, Kooperation, Schutz durch die Gemeinschaft.
- Beispielsätze: 👉 „So schlimm ist das alles doch gar nicht, wir schaffen das schon.“👉 „Lasst uns den Konflikt nicht größer machen, als er ist.“👉 „Wir sollten jetzt einfach alle ruhig bleiben und weitermachen.“
5. Tagträumen & Fantasieren
- Evolutionäre Herkunft:Frühe Menschen simulierten Jagd, Flucht, (Anbau-)Pläne, neue Werkzeuge, soziale oder Zukunftsszenarien. Tagträumen war Überlebenstraining.
- Neuro-Hintergrund: Das Default Mode Network (DMN) springt an, wenn wir nicht fokussiert sind. Es ist zuständig für Selbstreflexion, Zukunftssimulation, soziale Szenarien.
- Psychologische Bedürfnisse: Sinn, Orientierung, Inspiration.
- Beispielsätze: 👉 „Stell dir vor, wie es wäre, wenn wir in fünf Jahren doppelt so groß wären!“👉 „Ich sehe schon, wie wir als Team eine ganz neue Arbeitskultur entwickeln.“👉 „Wenn wir das schaffen, könnte daraus etwas richtig Großes entstehen.“
6. Mantra & Wiederholung, Selbstberuhigung
- Evolutionäre Herkunft: Rhythmus und Wiederholung waren seit jeher Werkzeuge zur Regulierung. Rituale, Gesänge, Trommeln regulierten Emotionen wie Angst und gaben Halt. Durch Rhythmus induzierte Trancezustände führten zu Selbstranszendenz.
- Neuro-Hintergrund: Basalganglien (Rhythmus), limbisches System (Beruhigung).
- Psychologische Bedürfnisse: Stabilität, Selbstregulation, Sicherheit, Stressabbau.
- Beispielsätze: 👉 „Immer eins nach dem anderen, Schritt für Schritt.“👉 „Das haben wir schon einmal geschafft, also schaffen wir es wieder.“👉 „Ruhe bewahren, tief atmen, weitermachen.“
7. Humor & Selbstironie
- Evolutionäre Herkunft:Humor war ein Hierarchiepuffer, um Statuskämpfe spielerisch zu lösen, baute Spannungen ab und sicherte das Überleben in Gruppen. Ironie und Sarkasmus verpackten dazu noch Kritik.
- Neuro-Hintergrund: Dopamin, Endorphine, präfrontaler Kortex.
- Psychologische Bedürfnisse: Freude, Leichtigkeit, Verbindung, Akzeptanz.
- Beispielsätze: 👉 „Na, wenn das hier klappt, schreibe ich ein Buch: ‚Überleben im Change-Dschungel‘.“👉 „Ich hoffe, die Kaffeemaschine übersteht diesen Change – sonst sind wir verloren.“👉 „Wenn ich mich noch mehr anpasse, bekomme ich einen Preis für Tarnung.“
8. Klagen über Ungerechtigkeit
- Evolutionäre Herkunft: Lamentieren über Ungerechtigkeiten war oft ein Signal: „Ich suche Mitstreiter, um etwas zu ändern.“ Es stärkte Koalitionen gegen dominantes Verhalten. Fairness-Klagen stärkten so Solidarität und zügelten Macht. Wer Gerechtigkeitsmisstände ansprach, gewann Allianzen.
- Neuro-Hintergrund: Aktivierung des Belohnungszentrums (Dopamin) wenn andere mitschwingen → soziale Resonanznetzwerke
- Psychologische Bedürfnisse: Fairness / Gerechtigkeit, Wirksamkeit, Teilgabe, Mitsprache.
- Beispielsätze: 👉 „Es ist doch unfair, dass immer nur eine Abteilung die Mehrarbeit tragen muss!“👉 „Warum werden wir nie gefragt, bevor die Entscheidungen fallen?“👉 „Andere bekommen Anerkennung, und wir sollen einfach nur mitziehen?“
🧬 Die wissenschaftliche Basis
Diese Archetypen sind nicht aus der Luft gegriffen – sie sind verankert in interdisziplinärer Forschung:
- Anthropologie: Robin Dunbar (Sprache als soziales Grooming), Christopher Boehm (Fairness & Hierarchie), Joseph Henrich (Kultur als Erfolgsfaktor) und viele mehr.
- Neurowissenschaft: James Coan (Social Baseline Theory: Nähe reduziert Stress), Stephen Porges (Polyvagal-Theorie: Sicherheit & Beziehung), Marcus Raichle (Default Mode Network), Mathew Liberman (Social), meine Neuro-Ausbildungsinhalte nach Damir del Monte uvm.
- Psychologie: Klaus Grawe (Neuropsychologie, Psychologische Grundbedürfnisse), Deci & Ryan (Motivation), Hubert Hermans (Dialogical Self), Charles Fernyhough (innere Sprache), Randolph Nesse, Motivkompass und Emotions- und Bindungsforschung nach Dr. Dirk W. Eilert, uvm.
- Und natürlich inspiriert aus meinen zahlreichen Coachingausbildungen, Hypnotherapie nach Milton Erickson und Beschäftigung mit verschiedenen Therapiekonzepten sowie meinem Kommunikationswissenschaftlichen Hintergrund.
⚠️ Wenn Stimmen kippen: Adaptiv – maladaptiv – transformativ
Jede dieser Stimmen kann drei Gestalten annehmen:
- Adaptiv: Sie erfüllt ihren ursprünglichen Zweck.
- Maladaptiv: Sie läuft im Kreis, blockiert, schadet, geht in den Schatten.
- Transformativ: Sie wird bewusst genutzt – und zur Ressource.

Beispiele pro Archetypischer Stimme
. Jammern & Klagen (Bindung)
- Adaptiv: Signalisiert Bedürftigkeit → andere werden aufmerksam, Nähe wird hergestellt.
- Maladaptiv: Dauerjammern erzeugt Abwehr, führt zu sozialer Isolation.
- Transformativ: Jammern bewusst umwandeln in gezielte Kontaktaufnahme („Ich brauche Unterstützung“), oder in Feedback-Kultur („Ich wünsche mir …“).
2. Grübeln & Sorgen (Sicherheit)
- Adaptiv: Hilft, Gefahren zu antizipieren, gute Vorbereitung auf Szenarien.
- Maladaptiv: Endlosschleifen → Angststörung, Lähmung, Entscheidungsunfähigkeit.
- Transformativ: Grübeln in strukturierte Risikoanalyse & Handlungsplanung verwandeln: „Was ist das Worst-Case-Szenario – und mein Plan B?“
3. Selbstkritik & Antreiber (Status)
- Adaptiv: Fördert Disziplin, Selbsteinschätzung, Lernfähigkeit.
- Maladaptiv: Selbstabwertung, Perfektionismus, Burnout.
- Transformativ: Selbstkritik in Selbstcoaching verwandeln: innere Stimme als „Mentor“ nutzen, nicht als Richter („Was kann ich daraus lernen?“).
4. Beschwichtigen & Schönreden (Kooperation)
- Adaptiv: Glättet Konflikte, fördert Gruppenkohäsion.
- Maladaptiv: Unterdrückt eigene Bedürfnisse, erzeugt innere Resignation.
- Transformativ: Aus Beschwichtigung wird authentische Vermittlung: klare Ich-Botschaften, gewaltfreie Kommunikation, Fähigkeit Spannungen zu halten.
5. Tagträumen & Fantasieren (Sinn)
- Adaptiv: Kreativität, Zukunftsvision, Innovationsfähigkeit.
- Maladaptiv: Realitätsflucht, Aufschieberitis, Vermeidung.
- Transformativ: Fantasien als Zukunftswerkzeug nutzen: Vision-Boards, Szenarienarbeit, kreative Planung.
6. Mantraartige Wiederholung & Selbstberuhigung (Regulation)
- Adaptiv: Selbstberuhigung, Stressreduktion, Resilienz.
- Maladaptiv: Zwanghaftes Wiederholen, rigide Rituale, Blockaden.
- Transformativ: Rituale bewusst in Selbstfürsorge-Praktiken verwandeln: Achtsamkeit, Embodiment, Atemtechniken wie HRV-Atmung.
7. Humor & Selbstironie (Freude)
- Adaptiv: Baut Brücken, entlastet Spannungen, macht verletzliches zeigbar.
- Maladaptiv: Zynismus, Abwehr, Sarkasmus als Distanzierung.
- Transformativ: Humor als kreative Ressource und Führungsinstrument nutzen, z. B. Storytelling, spielerisches Lernen, humorvolle Intervention.
8. Klagen über Ungerechtigkeit (Fairness)
- Adaptiv: Sammelt Koalitionen, fördert Gerechtigkeit, stärkt Solidarität.
- Maladaptiv: Dauerschleifen von Empörung, Opferhaltung, Spaltung.
- Transformativ: Empörung in Handlungsenergie kanalisieren: Allianzen bilden, aktiv Gerechtigkeit gestalten, kollektive Intelligenz nutzen. In Regeln überführen
🚀 Praxis: Was heißt das für Coaching, Führung und Veränderung?
Coaching
Coaches können innere Stimmen entschlüsseln.
- Erkennen: Welche Archetypen sind aktiv?
- Übersetzen: Welches Bedürfnis steckt dahinter?
- Transformieren: Von maladaptiv zu transformativ. 👉 Grübeln → Plan B entwickeln. 👉 Jammern → Unterstützung klar einfordern.
Wie erkenne ich Muster im Inneren?
- Achte auf Sprache & Tonalität des Coachees: – „Immer passiert mir das…“ → Jammern & Klagen (Bindung) – „Ich sollte mehr leisten…“ → Selbstkritik & Antreiber (Status) – „Ich habe Angst, dass…“ → Grübeln & Sorgen (Sicherheit) – „Eigentlich ist alles gut…“ (vermeidendes Lächeln) → Beschwichtigen & Schönreden (Kooperation)
- Nutze Fragen, die Muster entlarven: – „Was versuchst du mit dieser Stimme zu erreichen?“ – „Welches Bedürfnis steckt darunter?“
Was sagt mir das als Coach?
- Die Stimme zeigt ein nicht erfülltes Grundbedürfnis (Bindung, Sicherheit, Status, Kooperation, Sinn, Regulation, Freude, Fairness).
- Sie ist ursprünglich adaptiv, aber evtl. maladaptiv geworden.
Wie arbeiten?
- Externalisierung: „Wenn diese Stimme eine Figur wäre – wer wäre das?“
- Transformation: „Wie würde diese Stimme klingen, wenn sie dir als Mentor dient?“
- Integration: Klient:in erkennt: Es ist nicht „ich bin so“, sondern „ein Teil von mir spricht gerade so“.
👉 Ziel im Coaching: Selbststeuerung stärken, Muster bewusst wahrnehmen, Bedürfnis erkennen und konstruktiv erfüllen.
Führung
Führungskräfte hören Stimmen nicht nur im Team – sie sind Signale.
- Jammern = Bedürfnis nach Einbindung.
- Grübeln = Wunsch nach Sicherheit.
- Kritik = Suche nach Status & Anerkennung.
Wer das erkennt, kann Energie in Handlung leiten, statt sich von „Störgeräuschen“ irritieren zu lassen.
Wie erkenne ich Muster in der Führungssituation?
- Teammitglieder bringen ihre inneren Stimmen in äußere Sprache.
Was bedeutet das für Führung?
- Diese Muster sind keine Widerstände, sondern Signale von Bedürfnissen.
- Führungskraft muss übersetzen lernen: „Was will uns diese Stimme sagen?“
Wie arbeiten?
- Validierung statt Abwehr: Jammern nicht abwürgen, sondern „Ich höre, dass dir Zugehörigkeit wichtig ist.“
- Kanalisieren: Sorgen in Risiko-Management einfließen lassen → Verantwortung übernehmen.
- Transformieren & Rahmen setzen: Durch coachende Führung und systemische Fragen transformieren, Grenzen in der Führung setzen („Jammern nur über das was wir selbst in der Hand haben.“)
- Humor nutzen: Teamhumor kann Spannungen entlasten – aber als Leader differenzieren zwischen konstruktivem Lachen vs. zynischem Sarkasmus.
👉 Ziel in Führung: Signale deuten, Bedürfnisse adressieren, ggf. Ausrücke transformieren und Energie in Handlung umleiten.
Veränderungsbegleitung
In Change-Prozessen werden innere Stimmen zu äußeren Stimmen – oft laut.
- „Das ist unfair!“ → Bedürfnis nach Transparenz.
- „Das wird nie funktionieren.“ → Bedürfnis nach Sicherheit.
- „Wir müssen härter arbeiten!“ → Bedürfnis nach Status & Einfluss.
Wer diese Stimmen nicht bekämpft, sondern übersetzt, schafft Räume für Vertrauen und Teilgabe.
Wie erkenne ich Muster in Veränderungsprozessen?
- Organisationen sprechen oft wie eine „innere Psyche im Außen“. Zuhörformate schaffen.
Was sagt mir das?
- Jede Stimme ist Ausdruck eines kollektiven Bedürfnisses.
- Sie markiert die emotionale Landkarte der Organisation – was gebraucht wird, um im Wandel sicher zu bleiben.
Wie arbeiten?
- Mapping der Stimmen: Stimmen sammeln (z. B. in Workshops als „innere Archetypen der Organisation“).
- Übersetzen: Welche Grundbedürfnisse sind sichtbar? → daraus Change-Kommunikation ableiten.
- Transformation ermöglichen: – Jammern → „Wir wollen mehr eingebunden sein.“ → Beteiligungsformate. – Grübeln → „Wir haben Angst vor Risiken.“ → Klarheit & Pilotprojekte. – Fairnessklage → „Andere werden bevorzugt.“ → Transparente Regeln.
👉 Ziel in Veränderungsprozessen: innere Stimmen externalisieren, sichtbar machen und in kollektive Lernprozesse überführen.
Fazit: Stimmen als Kompass
Innere Redeformen sind kein Problem. Sie sind das Echo unserer evolutionären Geschichte – und gleichzeitig ein Navigationssystem für Führung, Coaching und Veränderung.
- Coaches können Erkenntnisse ermöglichen und Selbststeuerung stärken.
- Führungskräfte können Bedürfnisse erkennen und adäquat führen und kommunizieren, transformieren.
- Change-Begleiter:innen können Stimmen übersetzen und in Maßnahmen überführen.
🎤 Mein Angebot
Ich habe dieses Modell – die Archeologie der inneren Sprache – aus vielen Inspirationen zusammengestellt, um es praktisch nutzbar zu machen:
👉 Vorträge und Inspirationen wie mein Vortrag zu „Wirksamer Sprache in Veränderungen und Transformationen 👉 Workshops und Trainings für Führungskräfte, unter anderem zu Führungskommunikation, Veränderungen und professioneller Umgang mit Emotionen 👉 Fortbildungen für Coaches und Veränderungsbegleitende in wirksamer Sprache und narrativer Begleitung 👉 Organisationsbegleitung im Change und Transformation, Organisationsentwicklunh
➡️ Wenn du Lust hast, tiefer einzutauchen – lass uns sprechen.
Ich werde auch noch mal pro Archetyp einen Post als Serie einplanen.
Meine Frage an Dich: Welche dieser Stimmen hörst du in deinem Alltag am häufigsten? Und was machst du daraus?
Schreib es in die Kommentare – ich freue mich auf den Austausch. Auch gerne zur Weiterentwicklung des Modells. Gib mir gerne Feedback.